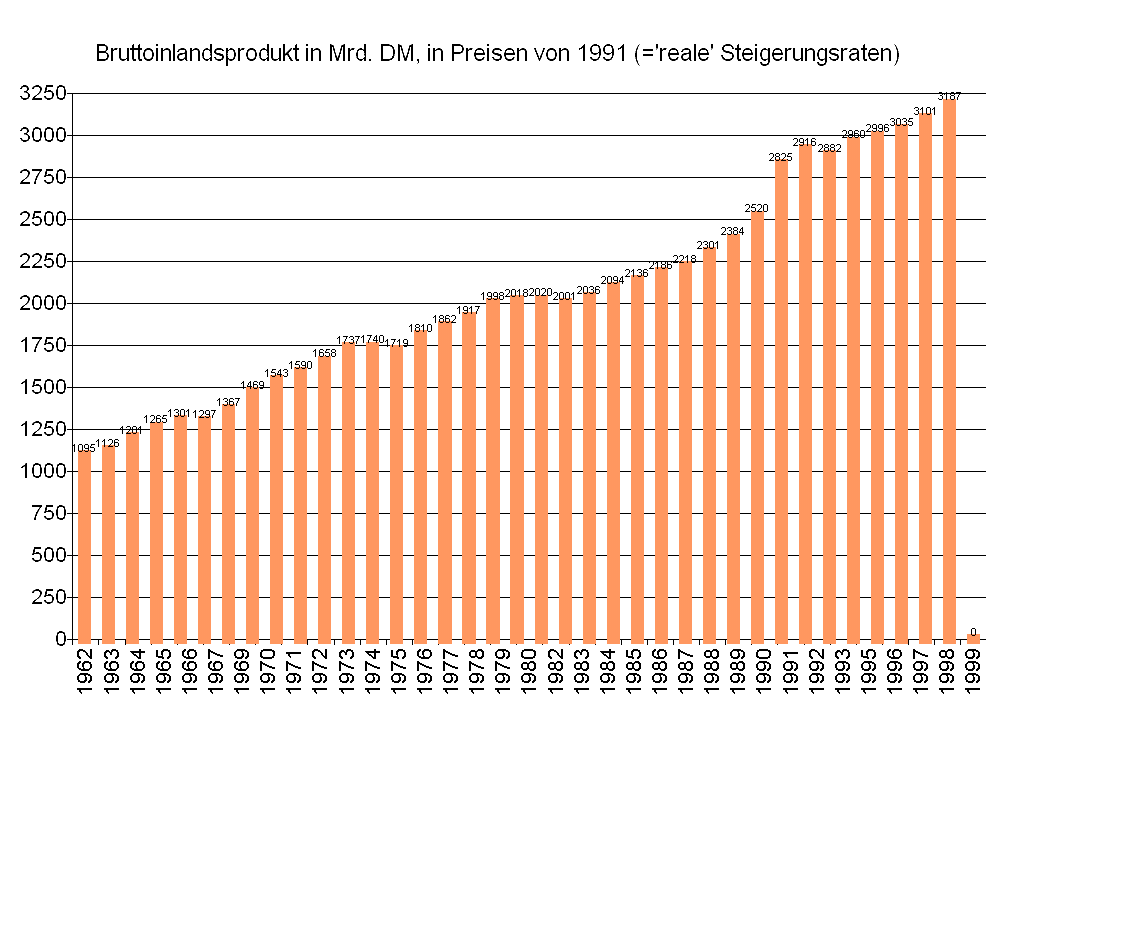 <1.2a>
<1.2a>
Kurzfassung des Buches 'Die Arbeitslosigkeit überwinden können wir nur mit einem solidarischen Sozialsystem'
Die Schlussfolgerung vorweg: Die Krise unseres Landes ist nicht eine Wirtschafts-, sondern eine Sozial- und Gesellschaftskrise; sie kann deshalb nicht durch Wirtschaftspolitik gleich welcher Art - weder durch 'angebotsorientierte' noch durch 'nachfrageorientierte' - oder durch Finanzpolitik überwunden werden, sondern nur durch die Einführung eines neuen, auf dem Prinzip des Grundeinkommens beruhenden Steuer- und Sozialsystems, also durch Gesellschaftspolitik.
Der zu dieser Schlussfolgerung führende Gedankengang und die ihm zugrundeliegenden Fakten in Kurzform (siehe dazu die Schaubilder):
B) Das real fast ständig zunehmende Bruttoinlandsprodukt konnte dabei, dank dem rasanten technischen Fortschritt und dank der internationalen Arbeitsteilung, mit immer geringerem Arbeitsaufwand erzeugt werden (Schaubild 1-2b). Unsere Volkswirtschaft ist also sehr leistungsfähig und wird immer leistungsfähiger; der Begriff 'Wirtschaftskrise' ist demnach völlig unangebracht und irreführend.
C) Wenn man die deutsche Bevölkerung als eine große Familie auffassen könnte, wäre unsere Situation ideal: Immer höherer Wohlstand bei immer weniger Arbeit!
E) Die Werte der Linien 'a' in den Schaubildern 1-3 und 1-3-z enthalten auch sämtliche Lohn-nebenkosten, sie stellen folglich die gesamten volkswirtschaftlichen Arbeitskosten dar. Wie aus dem Schaubild 1-3-z ersichtlich, ist der Anteil der Arbeitskosten am Bruttoinlandsprodukt in den letzten Jahren erheblich gesunken. Die Behauptung, eine Verminderung der Arbeitskosten würde - für die Volkswirtschaft als Ganzes - zu mehr Beschäftigung führen, wird allein schon dadurch widerlegt. Auch eine ganzheitliche, unvoreingenommene Überlegung führt zu der Erkenntnis, dass die volkswirtschaftliche Arbeitsmenge nicht von den volkswirtschaftlichen Arbeitskosten abhängt.
F) Ebenfalls als eine Täuschung erweist sich die Behauptung, 'die Wirtschaft' brauche höhere Gewinne und niedrigere Steuern, dann würde sie mehr investieren und so - per Saldo - mehr Arbeitsplätze schaffen. Denn seit 1993 sind die Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt stark gestiegen, wobei der Steueranteil gefallen ist (Schaubild 1-3-z). Im gleichen Zeitraum hat die volkswirtschaftliche Arbeitsmenge aber weiter abgenommen (Schaubild 1-2). Offensichtlich werden hohe Gewinne immer häufiger zum Aufkauf anderer Unternehmen verwendet, und immer mehr Investitionen dienen der Rationalisierung, dem Abbau von Arbeitsplätzen.
G) Die Hoffnung auf ein 'Bündnis für Arbeit' in dem Sinne, dass die Arbeitnehmer bzw. ihre Gewerkschaften auch weiterhin auf einen Teil des Lohnzuwachses verzichten und die Arbeitgeber mit dem ersparten Geld neue Arbeitsplätze schaffen würden, erweist sich somit als trügerisch.
H) Ebenfalls trügerisch ist folglich die Hoffnung, dass durch die Senkung der Lohnnebenkosten im Zuge der 'ökologischen Steuerreform' per Saldo neue Arbeitsplätze entstehen werden.
I)
Die Behauptung, wegen der angeblich zu hohen deutschen Arbeitskosten sei
der 'Wirtschaftsstandort Deutschland' nicht genügend wettbewerbsfähig,
wird auch. durch das Schaubild 1-4 widerlegt: Die Ausfuhr von Waren und
Dienstleistungen ist, nach dem Einschnitt durch die Wiedervereinigung,
schneller gewachsen als die Einfuhr.
J) Ausfuhr und Einfuhr können jedoch nicht sehr verschieden voneinander sein, denn das Ausland (künftig: das Euro-Ausland) muss wertmäßig etwa gleichviel ins DM- bzw. Euro-Gebiet verkaufen wie es von dort bezieht, weil es sonst nicht genügend D-Mark bzw. Euro zur Bezahlung hätte. Eine Steigerung der E x p o r t e - gemäß den Schlagworten 'Innovationen', 'neue Produkte', 'neue Märkte' - kann und wird also innerhalb eines Währungsgebietes per Saldo nicht zu mehr Beschäftigung führen, weil dann zum Ausgleich andere Wirtschaftszweige (z.B. Textilindustrie, Spielwaren, Schiffbau) noch mehr als bisher unter I m p o r t druck geraten.
K) Wer seine Hoffnung auf Zehn- oder Hunderttausende zusätzlicher Existenzgründer setzt, muss sich fragen lassen, welche neuartigen Produkte diese herstellen bzw. welche neuartigen Dienstleistungen diese vielen neuen Firmen anbieten sollten.
L) Den meisten der vielen falschen Rezepte gegen die Arbeitslosigkeit liegt einundderselbe Denkfehler zugrunde: B e t r i e b s wirtschaftlich gültige Beziehungen werden unkritisch auf die gesamte V o l k s wirtschaft übertragen; dort treffen jedoch viele dieser Beziehungen nicht mehr zu.
M) 'Geld ist Macht' - und Macht bringt Geld -- das Schaubild 1-3-z zeigt nicht nur eine Einkommensverschiebung auf, sondern ist gleichzeitig ein Abbild der schleichenden M a c h t verschiebung zwischen Kapital und Arbeit, des ständigen Machtzuwachses der Kapitaleigner und des fortschreitenden Machtverlustes der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften.
N) Dies ist ein sich selbst verstärkender Vorgang. Denn viele derjenigen Arbeitnehmer, die noch einen Arbeitsplatz haben, fühlen sich gezwungen oder veranlasst, zum Erhalt ihres Arbeitsplatzes immer intensiver, eventuell auch - zum Teil sogar sogar ohne Bezahlung - länger zu arbeiten, was jedoch, zusammen mit dem technischen Fortschritt, den zunehmenden Fusionen und der internationalen Arbeitsteilung, dazu führt, dass andere Arbeitsplätze wegrationalisiert werden können. Die fortschreitende Machtverschiebung zwischen Kapital und Arbeit ist demnach sowohl Ursache als auch Folge der Arbeitslosigkeit - ein Teufelskreis! Noch anders ausgedrückt: Die Marktwirtschaft ist bezüglich der Einkommensverteilung und der Machtbalance ein l a b i l e s System.
O) Die Krise ist deshalb weder durch ein 'Bündnis für Arbeit' noch durch Finanz- oder Wirtschaftspolitik überwindbar, sondern nur durch einen massiven, ständigen Eingriff des Staates in die Einkommensverteilung. Der neuzeitliche 'Raubtierkapitalismus' (so nennt ihn Altbundeskanzler Helmut Schmidt) kann sich nicht selbst zähmen, sondern er muss - im Interesse a l l e r Bürgerinnen und Bürger, auch derjenigen, die finanziell von der krisenhaften Entwicklung profitieren - vom Staat gezähmt werden, damit der innere Frieden erhalten bleibt.
P) Die allermeisten der bisherigen Rezepte gegen die Arbeitslosigkeit haben letztendlich ein so starkes Wirtschaftswachstum zum Ziel, dass trotz der schnell steigenden Arbeitsproduktivität (siehe Schaubild 1-2) die volkswirtschaftliche Arbeitsmenge wieder zunimmt. Dies ist jedoch in einer hochentwickelten Wirtschaft kaum erreichbar und wäre außerdem ökologisch äußerst nachteilig.
Q) Ganz im Gegenteil wird die volkswirtschaftliche Arbeitsmenge nach aller Wahrscheinlichkeit auch weiterhin abnehmen - schneller oder langsamer, je nach der Konjunktur. Folglich liegt die einzige (und, sowohl ökologisch als auch gesellschaftlich gesehen, einzig vernünftige) Möglichkeit zur Überwindung der Arbeitslosigkeit darin, dass - im Durchschnitt - alle Erwerbstätigen kürzer als bisher arbeiten.
R)
Kürzere (Lebens-, Jahres- oder/und Wochen-) Arbeitszeiten lassen sich
jedoch weder durch staatliche Arbeitszeitfestlegungen noch durch Überredung
der Tarifpartner im Rahmen eines 'Bündnisses für Arbeit' erreichen.
Denn:
- Staatliche Arbeitszeitfestlegungen widersprächen erstens der
Tarifautonomie, zweitens würden die dann notwendigen Kontrollen zu
einem bürokratischen Dickicht ohnegleichen führen, drittens ist
Mehrarbeit - vor allem für qualifizierte Mitarbeiter - im Falle von
Auftragsschwankungen oder Entwicklungsproblemen manchmal unausweichlich
und kann auch nur bedingt durch spätere Freizeit abgegolten werden,
und viertens passen staatliche Arbeitszeitfestlegungen nicht zu dem Ziel,
auf freiwilliger Basis zu möglichst viel Teilzeitarbeit überzugehen.
-
Die Unternehmen stehen unter dem Druck des Weltmarktes, die Unternehmensleiter
stehen unter dem Druck der Kapitaleigner und der 'Analysten'. Jedes Unternehmen
wird deshalb - legitimerweise - auch künftig bestrebt sein, das bestmögliche
Geschäftsergebnis zu erzielen, unabhängig von eventuellen Vereinbarungen
der Sprecher von Unternehmensverbänden mit den Gewerkschaften. Kürzere
Arbeitszeiten, selbst ohne betriebsseitigen Lohnausgleich, bringen aber
in der Regel etwas höhere Kosten mit sich. (Anmerkung: Einige bemerkenswerte
Arbeitszeitvereinbarungen in Groß-unternehmen, vor allem der Autobranche,
sind nicht auf die Volkswirtschaft als Ganzes übertragbar.)
- Wie das Schaubild 1-3 zeigt, hat die Netto-Lohn- und -Gehaltssumme
in den letzten Jahren nicht mehr zugenommen; wegen der Geldentwertung ist
sie also real sogar gefallen. Deshalb können und werden viele Arbeitnehmer
nicht auf einen Teil ihres Arbeitseinkommens verzichten, und einen betriebsseitigen
Lohnausgleich bei kürzerer Arbeitszeit werden die Arbeitgeber ablehnen.
S) Durchschnittlich kürzere Arbeitszeiten für die gesamte Volkswirtschaft lassen sich folglich nur durch staatlich vorgegebene finanzielle Anreize erreichen; diese müssten so beschaffen sein, dass es für Geringverdienende finanziell m ö g l i c h und für alle Erwerbstätigen a t t r a k t i v wird, zugunsten von mehr Freizeit auf einen Teil des bisherigen Arbeitseinkommens zu verzichten.
T) Die beste - vielleicht sogar einzig mögliche - Form solcher Anreize ist ein auf dem Prinzip des 'Grundeinkommens' beruhendes neues Steuer- und Sozialsystem (siehe Schaubild 3-3 und Buchtext).
U) Ein solches System würde darüberhinaus den Prozess der fortschreitenden sozialen Spaltung stoppen und dem Ausmaß der sozialen Ungleichheit eine Schranke setzen. Durch seine existenzsichernde Wirkung würde es die Arbeitnehmer befähigen, dem Wettbewerbsdruck besser als bisher zu widerstehen. Die Steigerung der Altersrenten und damit auch der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung könnte - zugunsten der jüngeren Generation - begrenzt werden, ohne dass dadurch Altersarmut entstünde. Die volkswirtschaftliche Nachfrage würde stabilisiert.
V) Ferner kann erst auf der Basis eines solchen Systems die - aus ökologischen Gründen dringend erforderliche - stetige Erhöhung der Energiesteuern sozialverträglich kompensiert werden, und zwar dadurch, dass die aus dem privaten Sektor kommenden Steuermehreinnahmen den Bürgerinnen und Bürgern mittels einer Erhöhung des 'Bürgergeldes' (siehe Buchtext) gleichmäßig zurückgegeben werden.
W) Unsere Gesellschaft braucht einen Systemverbund: Die Marktwirtschaft sorgt für hohen Gesamt-wohlstand; die Einführung eines neuen, auf dem Prinzip des Grundeinkommens beruhenden Steuer- und Sozialsystems sorgt dauerhaft für eine gerechte Verteilung und damit für soziale Stabilität und inneren Frieden
X) Der übersteigerte Wettbewerb ist unser modernes 'Trojanisches Pferd': Wir haben ihn in das Zentrum unserer Gesellschaft gestellt, und er wird unsere Gesellschaft zerstören, wenn wir ihn nicht eindämmen.
Y) Nur eine neue, entschlossene, der bedrohlichen Entwicklung angemessene Gesellschafts- und Sozialpolitik kann gegen soziale Spaltung und Arbeitslosigkeit helfen. Nicht durch noch mehr Wettbewerb kann die soziale Krise überwunden werden, sondern im Gegenteil nur durch mehr - und zwar staatlich garantierte - S o l i d a r i t ä t .
Z)
Die Folgen der 'Weltwirtschaftskrise' vor 70 Jahren (auch damals war es
eine S o z i a l krise!) und die heutigen sozialen Flammenzeichen - z.B.
aus Indonesien - sollten uns eine Warnung sein.